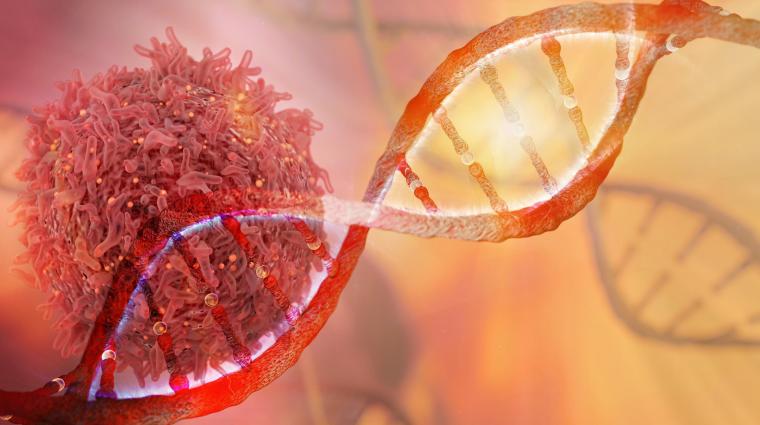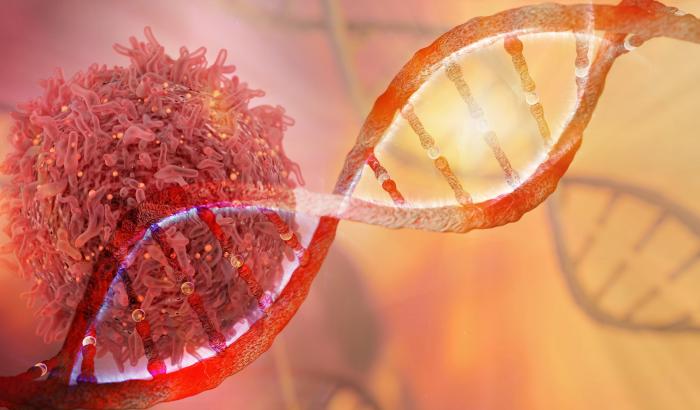University of Luxembourg
Forscher der Universität Luxemburg haben einen neuen Biomarker für Dickdarmkrebs gefunden, der die Therapie und die Überlebenschancen von Patienten verbessern könnte.
Forscher der Universität Luxemburg haben einen neuen Biomarker für Dickdarmkrebs gefunden, der die Therapie und die Überlebenschancen von Patienten verbessern könnte.
Biomarker sind messbare biologische Indikatoren für eine bestimmte Krankheit und zeigen z. B. Veränderungen bei der Anzahl bestimmter Proteine, die in Verbindung mit bestimmten Krankheiten auftreten. Solche Biomarker helfen Ärzten, ein Krankheitsbild zu diagnostizieren, das Krankheitsstadium zu identifizieren und das Risiko eines Patienten für ein Wiederauftreten der Krankheit zu ermitteln. Das erleichtert es dem Arzt, das am besten geeignete Therapiekonzept auszuwählen.
Bei Darmkrebs ist es besonders wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen und zu klassifizieren, da beispielsweise Chemotherapie nicht bei allen Patienten in späteren Stadien wirksam ist. Insbesondere die Identifizierung von Patienten mit einem Risiko für ein Wiederauftreten der Krankheit könnte für die Ärzte von großem Nutzen sein. Allerdings sind bisher nur wenige prognostische Marker für Darmkrebs bekannt, so dass zu viele Patienten immer noch unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie leiden, ohne einen tatsächlichen Nutzen zu haben.
Patienten mit Hilfe von Biomarker in Risikogruppe aufteilen
Vor kurzem hat ein interdisziplinäres Team aus Experimental- und Computerwissenschaftlern der Universität Luxemburg einen neuen und vielversprechenden Biomarker für Darmkrebs entdeckt. Insbesondere in frühen Stadien der Krankheit (Stadium I und II) könnten solche Marker es ermöglichen, Patienten in Gruppen mit „hohem“ und „geringem“ Risiko einzuordnen. Eine solche Klassifizierung kann Onkologen helfen, die geeigneten Behandlungsverfahren für den jeweiligen Patienten auszuwählen.
Das Forscherteam identifizierte die Proteinfamilie „Myosin“ und insbesondere das Protein „MYO5B“ als potentiellen prognostischen Marker für Darmkrebs. Mitglieder dieser Familie spielen eine wichtige Rolle bei der zellulären Transportsteuerung und der Polarisierung von Zellen. Ihre enge Verbindung mit verschiedenen Krebsarten wurde erst vor kurzem festgestellt.
Den neuen Biomarker identizierten die Forscher mit Hilfe einer zuvor aufgestellten Metaanalyse öffentlich verfügbarer Genexpressionsdaten.
Niedrige MYO5B Expressionslevels - schlechte Prognose
„Gemeinsam mit unseren Partnern waren wir in der Lage, hier in Luxemburg eine hochwertige Gewebesammlung von Darmkrebspatienten anzulegen. Nur die enge Zusammenarbeit mit der Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL), dem Laboratoire National de Santé (LNS), dem Centre d’Investigation et d’Épidémiologie Clinique (CIEC) und lokalen Krankenhäusern, vor allem dem Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), hat es uns ermöglicht, diese wichtigen Grundlagen für weitere Darmkrebs-Projekte zu legen“, erläutert Prof. Dr. Serge Haan, Leiter der MDM-Gruppe.
Neben der Fondation Cancer wurde die Studie ebenfalls vom Fonds National de la Recherche (FNR) unterstützt.
Editor: Michèle Weber (FNR)
Foto: Das Forscherteam der Universität Luxemburg © University of Luxembourg