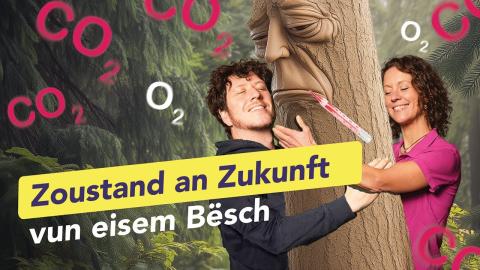AdobeStock/Julia
Die Lernstörung stellt viele Familien vor eine enorme Herausforderung.
Manche Kinder lernen mühelos zu lesen. Andere stolpern über Buchstaben und Wörter. Dabei sind sie genauso interessiert und aufgeweckt wie ihre Mitschüler. Gehen die Schwierigkeiten weit über das normale Maß hinaus, sprechen Fachleute von Dyslexie. Das ist eine spezifische Lernstörung. Sie ist seit Jahren Gegenstand intensiver Forschung, und doch bleiben viele Fragen offen.
Wie häufig kommt Dyslexie vor? Wie wird sie erkannt? Was sind die Ursachen? Und wie kann man den Kindern helfen? Wir haben die Antworten darauf für euch zusammengetragen.
In a nutshell: Was steckt hinter Dyslexie und wie hilft man Kindern?
- Dyslexie ist eine spezifische Lernstörung beim Lesenlernen, die nicht mit Fleiß oder Intelligenz zusammenhängt.
- Weltweit sind rund fünf bis acht Prozent der Kinder betroffen; in Luxemburg etwa 4.500, wobei Mehrsprachigkeit die Diagnose erschwert.
- Erste Anzeichen zeigen sich oft schon im Kindergarten, eine verlässliche Diagnose ist aber erst nach Beginn des Lesenlernens möglich.
- Jungen erhalten doppelt so häufig eine Diagnose wie Mädchen; häufig treten weitere Lernstörungen wie Dyskalkulie gemeinsam auf.
- Dyslexie entsteht durch genetische und neurobiologische Unterschiede in der Sprachverarbeitung; Unterrichtsqualität oder Mehrsprachigkeit beeinflussen nur den Schweregrad.
- Am wirksamsten sind Trainingsprogramme, die gezielt an der Laut-Buchstaben-Zuordnung ansetzen und regelmäßig angewendet werden.
- Schulen weltweit reagieren unterschiedlich: Inklusive Förderung funktioniert dort am besten, wo geschulte Fachkräfte und Ressourcen vorhanden sind.
- Dyslexie beeinflusst das ganze Leben. Doch frühe Förderung, Nachteilsausgleiche und gesellschaftliche Akzeptanz mindern Belastungen und eröffnen Chancen.
Was ist Dyslexie und was ist sie nicht?
Dyslexie ist weder eine Frage mangelnden Fleißes noch schlechten Unterrichts. Es ist eine anerkannte Lernstörung. Betroffene Kinder haben große Schwierigkeiten beim Lesenlernen. Sie verwechseln Buchstaben, brauchen deutlich länger für das Erkennen von Wörtern oder stolpern beim Vorlesen. Fachlich spricht man von einer „spezifischen Lernstörung mit Beeinträchtigung im Lesen“. So ist es in den internationalen Diagnosekatalogen definiert. Gemeint ist damit, dass die Probleme nicht durch fehlenden Schulbesuch, Seh- oder Hörschäden erklärt werden können. Häufig treten zusätzlich andere Auffälligkeiten auf, zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen oder Sprachprobleme.
Achtung: Hat ein Kind wenig geübt und liest deshalb langsam, liegt keine Dyslexie vor. Und sie hängt auch nicht mit der Intelligenz zusammen; Kinder mit sehr hohen IQ-Werten können ebenso betroffen sein wie solche mit durchschnittlichen oder niedrigen.
Infobox
Entwicklungsbedingte Dyslexie – um die es in diesem Artikel geht – zeigt sich in der Kindheit. Ursache sind Unterschiede in der Sprach- und Schriftverarbeitung im Gehirn, oft mit genetischen Faktoren im Hintergrund. In der internationalen Fachliteratur spricht man in diesem Fall einfach von Dyslexia.
Erworbene Dyslexie kann hingegen später im Leben auftreten – zum Beispiel nach einem Schlaganfall, einem Unfall oder einem Tumor. Betroffene verlieren dabei Fähigkeiten, die sie zuvor beim Lesen oder Schreiben schon sicher beherrscht hatten.
Im Deutschen wurde früher meist der Begriff „Legasthenie“ für die entwicklungsbedingte Form und „Dyslexie“ für die erworbene Form verwendet. Heute gilt diese Trennung als überholt; aktuelle Klassifikationen wie ICD-11 und DSM-5 fassen beide Varianten unter den spezifischen Lernstörungen mit Beeinträchtigung des Lesens zusammen.
Sylvia Costard: Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie. Hrsg.: Luise Springer, Dietlinde Schrey-Dern. Georg Thieme, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-13-139641-9
ICD10, Code R48.0 – Dyslexia and Alexia („Dyslexia and alexia“), https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/R00-R99/R47-R49/R48-/R48.0
ICD-10, Code F81.0, https://icdcodes.ai/diagnosis/dyslexia/documentation
Clinical Characteristics of Learning Disabilities, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK332886/
Wie häufig tritt Dyslexie auf?
Dyslexie ist eine spezifische Lernstörung. Weltweit sind im Schnitt rund fünf bis acht Prozent aller Kinder betroffen; je nachdem, welche Kriterien zur Diagnose angesetzt werden. Manche Studien kommen auch auf etwas niedrigere Werte, wenn sie sehr strenge Maßstäbe anlegen. Fachleute sind sich aber einig, dass Dyslexie überall vorkommt – und in jeder Schulklasse im Schnitt mindestens ein Kind betroffen ist.
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Diagnosen angestiegen. Fachleute sehen darin allerdings keine echte Zunahme der Störung, sondern führen den Effekt auf bessere Testverfahren und größerer Aufmerksamkeit zurück. Lehrer, Eltern und Ärzte erkennen heute schneller, wenn ein Kind Unterstützung braucht, und reagieren entsprechend.
In Luxemburg sind nach Schätzungen des Bildungsministeriums sind rund 4.500 junge Menschen betroffen. Die Diagnose ist hier zusätzlich kompliziert, weil Kinder in drei Sprachen lernen – Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Leseschwierigkeiten in einer Sprache können deshalb auch schlicht aus sprachlichen Unterschieden entstehen. Um das zuverlässiger auseinanderhalten zu können und Fehldiagnosen zu vermeiden, haben das Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET) der Universität Luxemburg und das Zentrum für Lernentwicklung Großherzogin Maria Teresa (CDA) spezielle Testverfahren entwickelt. Der „LuxLeseTest“ wird seit 2025 angewandt und soll erkennen helfen, ob ein Kind tatsächlich von einer Dyslexie betroffen ist oder ob es lediglich mehr Zeit braucht, um die einzelnen Sprachen sicher zu beherrschen.
Mehrsprachigkeit ist also kein Risiko an sich. Sie kann aber dazu führen, dass Kinder mit Dyslexie übersehen oder fälschlich stigmatisiert werden.
Infobox
Betrachtet man die Zahlen weltweit, ist mal von drei, mal von acht oder sogar zehn Prozent betroffener Kinder die Rede. Der Grund liegt weniger darin, dass Dyslexie in manchen Ländern häufiger wäre, sondern vor allem an den unterschiedlichen Messmethoden:
- Manche Studien setzen die Hürden für eine Diagnose sehr streng an, andere etwas lockerer.
- Manchmal wird nur das Lesen, manchmal auch die Rechtschreibung mitgezählt.
- Wie schwierig Lesenlernen ist, hängt auch von der Sprache ab: In Englisch weichen geschriebene und gesprochene Wörter oft stark voneinander ab, während Deutsch oder Finnisch viel regelmäßiger geschrieben werden. Dort entspricht ein Buchstabe meist einem Laut.
So entstehen sehr verschiedene Zahlen.
Yang, L.; Li, C.; Li, X.; Zhai, M.; An, Q.; Zhang, Y.; Zhao, J.; Weng, X. Prevalence of Developmental Dyslexia in Primary School Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. Brain Sci. 2022, 12, 240. https://doi.org/10.3390/brainsci12020240
Wagner RK, Zirps FA, Edwards AA, Wood SG, Joyner RE, Becker BJ, Liu G, Beal B. The Prevalence of Dyslexia: A New Approach to Its Estimation. J Learn Disabil. 2020 Sep/Oct;53(5):354-365. doi: 10.1177/0022219420920377. Epub 2020 May 26. PMID: 32452713; PMCID: PMC8183124.
Snowling, M. J. & Hulme, C. (2020): Annual Research Review: Reading disorders revisited – the critical importance of oral language. Journal of Child Psychology and Psychiatry. DOI: 10.1111/jcpp.13324
Peterson, R. L. & Pennington, B. F. (2015): Developmental dyslexia. Lancet. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60198-6/abstract
Elliott, J. G. & Grigorenko, E. L. (2014): The Dyslexia Debate. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139017824
Ministry of Education, Children and Youth. New Tools to Better Identify Learning Disabilities in Multilingual Environments. https://menej.gouvernement.lu/en/actualites.gouvernement2024%2Ben%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2025%2B04-avril%2B24-meisch-tests-troubles-apprentissage.html
Dyslexia affects 4,500 young people in Luxembourg. Luxembourg Times. https://www.luxtimes.lu/luxembourg/dyslexia-affects-4-500-young-people-in-luxembourg/1236837.html
Woran erkennt man Dyslexie und ab wann ist eine Diagnose verlässlich?
Erste Hinweise auf eine Dyslexie lassen sich schon im Kindergartenalter beobachten. Tun sich Kinder mit Reimen schwer, können sie Laute in Wörtern nicht unterscheiden oder Buchstaben und Lauten nur schwer eine Verbindung zuordnen, gelten sie als Risikokandidaten. Solche Signale deuten aber noch nicht sicher auf eine Dyslexie hin. Viele Kinder holen diese Fähigkeiten später von allein auf.
Eine zuverlässige Diagnose ist in der Regel erst möglich, wenn das Lesen systematisch unterrichtet wurde. Fachleute sehen dafür das Ende der ersten oder den Beginn der zweiten Grundschulklasse als sinnvoll an. Dann lässt sich mit standardisierten Tests feststellen, ob die Leseprobleme deutlich stärker ausgeprägt sind, als es durch normale Unterschiede in Tempo und Übung erklärbar wäre.
Screenings im Vorschulalter können also helfen, Kinder mit erhöhtem Risiko zu erkennen, haben aber auch eine hohe Fehlerquote. Deshalb sind sie eher als Warnsignal gedacht, nicht als endgültige Diagnose. Wichtig ist zudem, mögliche Begleiterkrankungen wie Aufmerksamkeitsstörungen oder Sprachentwicklungsprobleme zu berücksichtigen.
Infobox
Sanfilippo J, Ness M, Petscher Y, Rappaport L, Zuckerman B, Gaab N. Reintroducing Dyslexia: Early Identification and Implications for Pediatric Practice. Pediatrics. 2020 Jul;146(1):e20193046. doi: 10.1542/peds.2019-3046. Epub 2020 Jun 23. PMID: 32576595; PMCID: PMC7329249.
Snowling MJ, Hulme C. Annual Research Review: Reading disorders revisited - the critical importance of oral language. J Child Psychol Psychiatry. 2021 May;62(5):635-653. DOI: 10.1111/jcpp.13324. Epub 2020 Sep 21. PMID: 32956509.
Hulme, Charlesa; Snowling, Margaret J.b. Reading disorders and dyslexia. Current Opinion in Pediatrics 28(6):p 731-735, December 2016. 10.1097/MOP.0000000000000411
Wen trifft Dyslexie?
Dyslexie kann grundsätzlich jedes Kind betreffen; ganz unabhängig von Intelligenz oder sonstigen Begabungen. Besonders deutlich zeigt sich allerdings ein Geschlechterunterschied. Jungen erhalten etwa doppelt so häufig eine Diagnose wie Mädchen. Ob das an biologischen Faktoren liegt oder daran, dass Mädchen ihre Schwierigkeiten besser kompensieren und seltener auffallen, ist noch nicht eindeutig geklärt.
Auch das Umfeld spielt eine Rolle. Kinder aus bildungsnahen Familien werden meist früher getestet und gefördert, während andere länger übersehen werden können. Dadurch entstehen Unterschiede, die nicht mit der eigentlichen Störung zu tun haben, sondern mit dem Zugang zu Hilfsangeboten.
Oft tritt Dyslexie nicht allein auf. Häufig sind auch andere Lernschwierigkeiten oder Störungen beteiligt, zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizite oder Probleme beim Rechnen. Studien zeigen, dass etwa 40 Prozent der betroffenen Kinder gleichzeitig unter einer Dyskalkulie leiden. Laut Christine Schiltz von der Uni Luxemburg kommt Dyskalkulie in Luxemburg auch bei etwa 8% der Kinder vor.
Infobox
Neben Schwierigkeiten beim Lesen gibt es auch Kinder, die vor allem beim Rechnen Probleme haben. Das nennt man Dyskalkulie und davon sind schätzungsweise drei bis acht Prozent aller Schülerinnen und Schüler betroffen. Sie zeigt sich durch anhaltende Schwierigkeiten beim Verständnis von Zahlen, Mengen und Rechenoperationen. Wie auch die Dyslexie hat Dyskalkulie nichts mit der Intelligenz zu tun.
Häufig tritt Dyskalkulie gemeinsam mit Dyslexie auf. Studien zufolge sind rund 40 Prozent der betroffenen Kinder von beiden Lernstörungen gleichzeitig betroffen. Auch hier gilt: Frühzeitige Diagnose und gezielte Förderung sind entscheidend, um den Anschluss in der Schule nicht zu verlieren.
Wagner RK, Zirps FA, Edwards AA, Wood SG, Joyner RE, Becker BJ, Liu G, Beal B. The Prevalence of Dyslexia: A New Approach to Its Estimation. J Learn Disabil. 2020 Sep/Oct;53(5):354-365. doi: 10.1177/0022219420920377. Epub 2020 May 26. PMID: 32452713; PMCID: PMC8183124.
Willcutt EG, McGrath LM, Pennington BF, Keenan JM, DeFries JC, Olson RK, Wadsworth SJ. Understanding Comorbidity Between Specific Learning Disabilities. New Dir Child Adolesc Dev. 2019 May;2019(165):91-109. doi: 10.1002/cad.20291. Epub 2019 May 9. PMID: 31070302; PMCID: PMC6686661.
Joyner RE, Wagner RK. Co-occurrence of Reading Disabilities and Math Disabilities: A Meta-Analysis. Sci Stud Read. 2020;24(1):14-22. doi: 10.1080/10888438.2019.1593420. Epub 2019 Apr 3. PMID: 32051676; PMCID: PMC7015531.
Viesel-Nordmeyer, N., Reuber, J., Kuhn, JT. et al. Cognitive Profiles of Children with Isolated and Comorbid Learning Difficulties in Reading and Math: a Meta-analysis. Educ Psychol Rev 35, 34 (2023). https://doi.org/10.1007/s10648-023-09735-3
Feng W, Chotipanvithayakul R, Liu H. Prevalence of dyslexia related to mental health problems and character strengths among primary school students in northwest China. Aust J Psychol. 2024 Sep 9;76(1):2399114. doi: 10.1080/00049530.2024.2399114. PMID: 40666644; PMCID: PMC12218475.
Université du Luxemnourg. Detecting learning disorders: tests finally adapted to Luxembourg context. https://www.uni.lu/en/news/detecting-learning-disorders-tests-finally-adapted-to-luxembourg-context/
Was passiert im Gehirn beim Lesen und wie sieht das bei Dyslexie aus?
Beim routinierten Lesen arbeiten drei Bereiche im Gehirn Hand in Hand. Der sogenannte okzipitotemporale Kortex, ein Bereich weiter hinten im Gehirn, spielt eine Schlüsselrolle bei der Erkennung der geschriebenen Worte. Der temporo-parietale Kortex, ein Bereich eher mittig im Gehirn, verbindet Laute mit Buchstaben. Und der inferiore frontaler Gyrus im vorderen Bereich hilft beim Erkennen von Wortbedeutungen und innerem „Sprechen“. Bei geübten Leserinnen und Lesern läuft dieses Netzwerk äußerst automatisiert. Wörter werden oft auf einen Blick erkannt, ohne dass jeder Buchstabe einzeln verarbeitet werden muss.
Bei Kindern mit Dyslexie läuft dieses Zusammenspiel anders. Bildgebende Studien zeigen wiederkehrend ein Muster. Die für die schnelle visuelle Worterkennung zuständige Region ist weniger stark und weniger effizient aktiviert. Andere Bereiche versuchen, dies zu kompensieren. Dieser zusätzliche Ressourcenaufwand führt dazu, dass das Lesen für betroffene Kinder anstrengender ist und langsamer vonstattengeht.
Diese Unterschiede im Gehirn zeigen sich oft schon vor dem eigentlichen Lesenlernen; zum Beispiel, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, Laute zu unterscheiden oder zu reimen. Das zeigt sich in vielen Sprachen, auch wenn die genauen Muster davon abhängen, wie einfach oder schwierig die jeweilige Sprache geschrieben wird.
Wichtig zu wissen: Die Bildgebenden Studien zeigen Muster. Sie sagen aber nicht alles über einzelne Schicksale. Manche Kinder zeigen typische Dyslexie-Muster im Bild, lesen aber mit entsprechender Förderung gut. Andere Kinder haben starke Probleme, obwohl ihr Scan keine dramatischen Abweichungen zeigt. Bildgebung und Genetik erklären also Teile des Phänomens, aber nicht jeden Einzelfall.
Infobox
Christine Schiltz ist Professorin für kognitive/neuropsychologische Aspekte von Rechnen und Lesen an der Universität Luxemburg. Ihre Arbeit verbindet Verhaltensmessungen mit neuropsychologischen Methoden, um zu verstehen, wie Kinder in mehrsprachigen Umgebungen Schrift und Zahlen verarbeiten.
Dabei befasst sie sich mit zentralen Fragen, die für Luxemburg besonders relevant sind. Wie beeinflusst das Lernen in mehreren Sprachen die neuronale Organisation des Lesens? Und lassen sich sprachneutrale Tests entwickeln, die echte Lese-Störungen oder Rechen-Störungen von normaler Mehrspracherfahrung unterscheiden?
Norton ES, Beach SD, Gabrieli JD. Neurobiology of dyslexia. Curr Opin Neurobiol. 2015 Feb;30:73-8. DOI: 10.1016/j.conb.2014.09.007. Epub 2014 Oct 4. PMID: 25290881; PMCID: PMC4293303.
Benítez-Burraco, A. (2009): Neurobiology and Neurogenetics of Dyslexia. DOI: 10.1016/S2173-5808(20)70105-7
van de Walle de Ghelcke A, Rossion B, Schiltz C, Lochy A. Impact of Learning to Read in a Mixed Approach on Neural Tuning to Words in Beginning Readers. Front Psychol. 2020 Jan 23;10:3043. doi: 10.3389/fpsyg.2019.03043. PMID: 32038406; PMCID: PMC6989560.
Gigleux, C.; van de Walle de Ghelcke, A.; Christine Schiltz. Lexical brain responses in 10-year-old children are impaired in dyslexia: an FPVS-EEG study. 2025. DOI:10.1101/2025.07.20.665366
Marinova, Mila & Schiltz, Christine. (2025). Numerical format integration in primary school children examined with frequency-tagged electroencephalography. Scientific Reports. 15. DOI:10.1038/s41598-025-11281-7.
Profil von Prof. Christine Schiltz bei der Universität Luxemburg. https://www.uni.lu/fhse-en/people/christine-schiltz/
Was sind die Ursachen für Dyslexie?
Genetische Veranlagungen sind eine der Hauptursachen für eine Dyslexie. Dabei stehen mehrere Gene mit der Störung in Zusammenhang, die an der Entwicklung von Nervenzellen beteiligt sind. Kinder mit einem betroffenen Elternteil haben deshalb ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst Schwierigkeiten beim Lesenlernen zu entwickeln.
Daneben spielen neurobiologische Faktoren eine wichtige Rolle. In bildgebenden Verfahren zeigt sich, dass bei Kindern mit Dyslexie bestimmte Hirnregionen, die für die Verarbeitung von Sprache und Schrift wichtig sind, weniger effizient arbeiten.
Klar ist aber auch: Es gibt nicht die eine Ursache. Umweltfaktoren wie die Qualität des Unterrichts oder die Mehrsprachigkeit beeinflussen, wie stark eine Dyslexie zutage tritt; sie erklären sie aber nicht.
Was hilft bei einer Dyslexie?
Es gibt viele Versprechen, aber nur wenige Ansätze, deren Wirksamkeit wissenschaftlich gut belegt ist. Am zuverlässigsten wirken Programme, die systematisch an der Laut-Buchstaben-Zuordnung ansetzen. Kinder lernen dabei, wie Schrift und gesprochene Sprache zusammenhängen – etwa, wenn sie den Laut m hören und dazu den Buchstaben M schreiben. Dazu zerlegen sie Laute in Silben oder üben gezielt, Wörter in kleinere Einheiten zu unterteilen. Solche phonologisch basierten Förderprogramme zeigen in Studien weltweit die stärksten Effekte.
Entscheidend ist nicht nur die Methode, sondern auch die Intensität und Dauer. Mehrere Stunden Training pro Woche, über Monate hinweg, führen zu deutlich besseren Ergebnissen als kurze oder sporadische Förderung. Auch digitale Programme oder Apps können unterstützen, wenn sie auf diesen Prinzipien beruhen. Sie ersetzen aber keine gezielte Förderung durch geschulte Fachkräfte.
Andere Methoden wie Farbfilter-Brillen, „Gehirntraining“ oder spezielle Diäten konnten bislang in keiner Studie einen klaren Nutzen zeigen. Fachleute warnen deshalb vor falschen Hoffnungen und unnötigen Kosten.
Wirksamkeit heißt allerdings nicht schnelle Heilung. Kinder mit Dyslexie brauchen langfristige Unterstützung, damit sie den Anschluss in der Schule halten können. Dazu gehört neben gezielter Förderung auch ein Nachteilsausgleich im Unterricht. Das kann zum Beispiel mehr Zeit bei Prüfungen sein oder die Möglichkeit, Hilfsmittel zu benutzen.
Infobox
Galuschka, K. et al. (2014): Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089900
Enge, A. et al. (2023): A systematic review on interventions for children with dyslexia. DOI:10.11591/ijere.v12i3.25099
Snowling, M. J. & Hulme, C. (2012): Interventions for children’s language and literacy difficulties. International Journal of Language & Communication Disorders. https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2011.00081.x
Ojanen E, Ronimus M, Ahonen T, Chansa-Kabali T, February P, Jere-Folotiya J, Kauppinen KP, Ketonen R, Ngorosho D, Pitkänen M, Puhakka S, Sampa F, Walubita G, Yalukanda C, Pugh K, Richardson U, Serpell R, Lyytinen H. GraphoGame - a catalyst for multi-level promotion of literacy in diverse contexts. Front Psychol. 2015 Jun 10;6:671. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00671. PMID: 26113825; PMCID: PMC4461812.
Ronimus et al. (2020): A mobile game as a support tool for children with severe difficulties in reading and spelling. https://doi.org/10.1111/jcal.12456
Ahmed et al. (2020): An Evaluation of the Efficacy of GraphoGame Rime. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00132
International Dyslexia Association (2023): Fact Sheet on Dyslexia Interventions. https://dyslexiaida.org/
Wie reagieren Schulsysteme?
Der Umgang mit Dyslexie unterscheidet sich je nach Land erheblich. In vielen Bildungssystemen gilt inzwischen der Grundsatz der Inklusion. Kinder mit Dyslexie besuchen reguläre Klassen und erhalten dort spezielle Förderstunden oder Nachteilsausgleiche. Dazu gehören zum Beispiel verlängerte Arbeitszeiten bei Prüfungen, Vorlesesoftware oder die Möglichkeit, Computer für schriftliche Arbeiten zu nutzen.
In den nordischen Ländern, etwa in Finnland, ist diese Förderung besonders systematisch. Schon in der Grundschule gibt es verbindliche Screenings, und spezialisierte Lehrkräfte begleiten die Kinder eng. In Großbritannien und den USA sind Nachteilsausgleiche rechtlich verankert; Schulen sind verpflichtet, entsprechende Unterstützung anzubieten.
In Luxemburg gibt es mit dem Service de l’intégration et de l’éducation spéciale (S-IEBS) Strukturen zur Förderung. Zusätzlich entwickelt die Universität Luxemburg diagnostische Tests wie den LuxLeseTest und LuxMatheTest, um verlässliche Entscheidungen zu treffen.
In der Praxis ist die Umsetzung aber nicht überall gleich konsequent. Vieles hängt von der einzelnen Schule und den Lehrkräften ab. Ein Grundproblem bleibt dabei überall gleich: Wirksame Förderung erfordert Zeit, geschulte Fachkräfte und Ressourcen. Und genau die sind vielerorts knapp.
Infobox
European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2020): European Agency Statistics on Inclusive Education. https://www.european-agency.org/
Elliott, J. & Grigorenko, E. (2014): The Dyslexia Debate. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139017824
Snowling, M. J. (2013): Early identification and interventions for dyslexia: a contemporary view. Journal of Research in Special Educational Needs, 13(1), 7–14. https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x
Luxemburg – LuxLeseTest / LuxMatheTest: Pressemitteilung vom 24. April 2025, Bildungsministerium Luxemburg: „Neue Tests für die Erkennung von Dyslexie und Dyskalkulie“. https://menej.gouvernement.lu/de/actualites.gouvernement2024%2Bde%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2025%2B04-avril%2B24-meisch-tests-troubles-apprentissage.html
Welche Folgen hat Dyslexie für Betroffene?
Dyslexie begleitet Kinder und Jugendliche weit über die Grundschulzeit hinaus. Wenn Mitschüler schneller lesen oder wenn Noten systematisch schlechter ausfallen, können schon früh Frust, Scham und ein verringertes Selbstwertgefühl entstehen. Ohne gezielte Unterstützung wirkt sich das auf die gesamte Schullaufbahn aus. Betroffene geraten ins Hintertreffen bei fast allen Fächern, die auf Lesekompetenz aufbauen.
Auch später im Leben bleibt die Störung spürbar. Erwachsene mit Dyslexie berichten häufiger von Schwierigkeiten in Ausbildung und Beruf, vor allem in Tätigkeiten mit hohem Lese- und Schreibanteil. Viele von ihnen können zwar Strategien entwickeln, um ihre Schwächen zu kompensieren, dennoch bleibt das Lesen oft mühsamer.
Neben den schulischen und beruflichen Folgen sind die psychosozialen Belastungen erheblich. Studien zeigen ein erhöhtes Risiko für Angststörungen und Depressionen. Gleichzeitig berichten viele Betroffene, dass die Diagnose selbst eine Erleichterung war. Denn sie liefert eine Erklärung und öffnet den Weg zu gezielter Unterstützung.
Infobox
In der medizinischen Fachwelt wird Dyslexie als Störung klassifiziert. Parallel dazu gibt es aber eine gesellschaftliche Bewegung, die das Phänomen im Rahmen der Neurodiversität betrachtet. Danach gelten Unterschiede in der Informationsverarbeitung nicht als Defizite, sondern als Teil der natürlichen Vielfalt menschlicher Gehirne.
Befürworter dieser Sichtweise betonen, dass Menschen mit Dyslexie oft besondere Stärken haben, zum Beispiel im bildhaften Denken, in der Kreativität oder beim Erkennen komplexer Muster. Kritiker wenden dagegen ein, dass die Betonung solcher Stärken die realen Schwierigkeiten im Alltag nicht relativieren darf.
In der klinischen Forschung wird Dyslexie meist als spezifische Lernstörung beschrieben; die Neurodiversitätsbewegung versteht sie dagegen als Variante menschlicher Vielfalt. Beide Sichtweisen zeigen unterschiedliche Zugänge. Die eine betont die Herausforderungen im Alltag, die andere mögliche Stärken und Chancen.
Gerber PJ. The impact of learning disabilities on adulthood: a review of the evidenced-based literature for research and practice in adult education. J Learn Disabil. 2012 Jan-Feb;45(1):31-46. DOI: 10.1177/0022219411426858. Epub 2011 Nov 7. PMID: 22064950.
Eide, B. & Eide, F. (2011): The Dyslexic Advantage. Hudson Street Press. ISBN: 978-0452297920
Armstrong, T. (2011): The Power of Neurodiversity: Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain. Da Capo Press. ISBN: 978-0306836367
Singer, J. (2017): Neurodiversity: The Birth of an Idea. ISBN 978-0648154709
Armstrong T. The myth of the normal brain: embracing neurodiversity. AMA J Ethics. 2015 Apr 1;17(4):348-52. DOI: 10.1001/journalofethics.2015.17.4.msoc1-1504. PMID: 25901703.
Autor: Kai Dürfeld (für scienceRELATIONS - Wissenschaftskommunikation)
Redaktion: Michèle Weber (FNR)
Lektorat: Christine Schiltz (Universität Luxemburg)