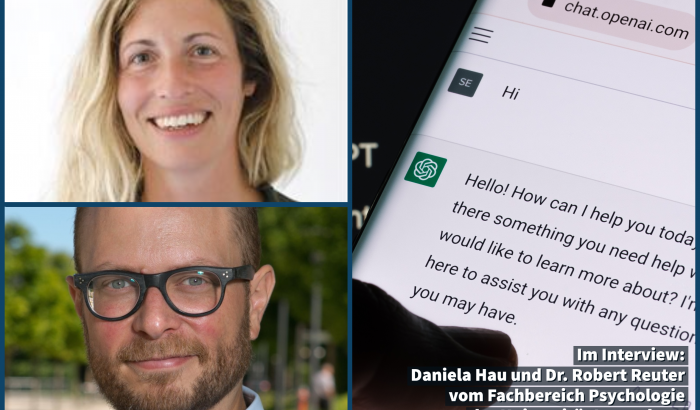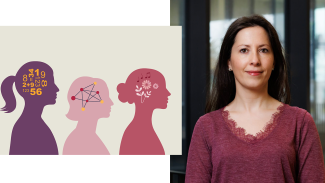
AdobeStock/MarLein & University of Luxembourg
Rechts: Dr. Andreia Costa
Die Psychologin Dr. Andreia Costa erforscht an der Universität Luxemburg, wie sich Autismus im Alltag zeigt – mit besonderem Blick auf Frauen. Im Gespräch erklärt sie, was in diesem Zusammenhang Camouflage bedeutet, warum Maskieren kurzfristig hilft und langfristig schadet, wie sich die Diagnosen verändert haben und was in Luxemburg konkret passiert, um Leben mit Autismus gelingen zu lassen.
Dr. Andreia Costa hat das science.lu-Team auch beraten für unser neuestes „Ziel mir keng“-Video zum Thema Autismus:
Frau Dr. Costa, woran forschen Sie aktuell – und warum liegt Ihr Schwerpunkt auf Frauen im Autismus-Spektrum?
Ich untersuche, wie es Autistinnen und Autisten in verschiedenen Lebensbereichen geht: Wie sie ihre Emotionen regulieren, in der Schule zurechtkommen oder den Übergang in den Job schaffen – und dort auch bleiben. Derzeit schaue ich mir an, welche Rolle „Camouflaging“ spielt: Also Strategien, mit denen Menschen im Spektrum „weniger autistisch“ wirken wollen. Das kann helfen, einen Job zu bekommen, macht es aber schwer, ihn zu halten – weil es enorm an den Kräften zehrt, die Maske immer hochzuhalten.
Für Frauen mit Autismus ist das besonders belastend, weil sie häufiger als Männer maskieren. Deshalb werden sie oft später oder gar nicht diagnostiziert - und bekommen weder Verständnis noch Unterstützung.
Was genau ist Camouflage – und warum ist es so belastend?
Camouflage heißt: Ich unterdrücke Verhaltensweisen, die mir eigentlich helfen, mit meinen autistischen Zügen zurecht zu kommen. Das kann für manche Menschen bedeuten, dass sie rhythmische und sich wiederholende Bewegungen unterdrücken. Oder Blickkontakt zu anderen Menschen aufnehmen, obwohl sie das sehr anstrengt. Andere imitieren soziale Signale, damit sie in die Gruppe passen. Insbesondere Frauen mit Autismus üben dafür Blickkontakt, Smalltalk oder - vor dem Spiegel - mimische Reaktionen.
Kurzfristig öffnet ihnen das Türen. Aber langfristig kostet es Authentizität und Energie: Viele Menschen im Autismus-Spektrum, die camouflieren, berichten, sie fühlten sich „nicht sie selbst“. Die Folgen sind häufig Angst, Depression – bis hin zu Suizidgedanken.
Warum wird Autismus bei Mädchen und Frauen so häufig übersehen?
Da greifen mehrere Gründe ineinander: Erstens äußern sich bei ihnen Schwierigkeiten oft „internalisiert“. Das heißt: Kein auffälliges Verhalten, sondern eher Angst oder Rückzug. Das fällt weniger auf, als wenn jemand auf äußere Reize mit Rückzug reagiert oder extrem auf Routinen angewiesen ist.
Zweitens sind ausgeprägte Interessen, die Mädchen entwickeln, oft sozial akzeptiert. Wenn sich zum Beispiel ein Mädchen sehr für Pferde interessiert, fällt das weniger auf, als wenn ein Junge ausschließlich über Lokomotiven redet. Solche Mädchen wirken unauffälliger; Eltern oder Lehrer denken nicht an Autismus.
Und drittens gibt es sozialen Druck: „Sei höflich, lächle, sei nicht so zappelig“. Das hören Mädchen immer noch häufiger als Jungen. So lernen sie früh, Erwartungen zu erfüllen und das Verhalten ihrer Mitmenschen zu spiegeln. Das alles erschwert die Diagnose – und erklärt, warum der zahlenmäßig vermeintlich große Abstand zwischen Männern und Frauen mit Autismus deutlich schrumpft, wenn man genauer hinschaut.
Wie hat sich die Diagnostik verändert – und warum steigen die Fallzahlen?
Zwei Dinge sind zentral: Bewusstsein und Kriterien. Heute wissen Eltern, Ärzte, Lehrer genauer, worauf sie achten müssen, um Kinder im Autismus-Spektrum zu erkennen, für eine korrekte Diagnose zu sorgen und die richtige Unterstützung anzubieten.
Und: Seit 2013 fasst das DSM-5, das Diagnosehandbuch der American Psychiatric Association, frühere Unterkategorien zu einem Spektrum zusammen; die Klassifikation der Weltgesundheit-Organisation ICD-11 zieht nach. Das hilft, unterschiedliche Ausprägungen von Autismus besser zu erkennen – auch bei Menschen ohne intellektuelle Beeinträchtigung und speziell bei Frauen.
Methodische Unterschiede erklären zusätzlich, warum etwa US-Zahlen höher liegen als europäische: Dort wird systematischer gescreent; Europa arbeitet vielfach mit älteren, heterogenen Datensätzen.
Warum „Autismus-Spektrum“?
„Spektrum“ heißt Bandbreite, nicht Skala von „leicht bis schwer“. Autistische Menschen zeigen unterschiedliche Muster aus Stärken und Herausforderungen, die sich über die Lebensspanne verändern können. Die Diagnose "Autismus-Spektrum" macht diese Muster sichtbar, damit passende Unterstützung geplant werden kann — ohne die Person auf ein Etikett zu reduzieren.
DSM-5 / DSM-5-TR (USA)
Das Diagnosehandbuch der American Psychiatric Association fasst seit 2013 (aktualisiert 2022) die früheren fünf Unterformen (u. a. „Asperger-Syndrom“) zur Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zusammen. Statt Schubladen beschreibt es vor allem Schweregrad und Unterstützungsbedarf in zwei Bereichen: soziale Kommunikation/Interaktion und eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster inkl. sensorischer Besonderheiten.
ICD-11 (WHO, international/EU)
Die aktuelle WHO-Klassifikation (ICD-11) folgt demselben Prinzip: ein Spektrum statt getrennter Typen. Auch hier stehen funktionale Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarf im Vordergrund. In Europa wird ICD für Abrechnung und Statistik benutzt.
Wie läuft eine Diagnose in Luxemburg konkret ab?
Die zentrale Anlaufstelle ist die Fondation Autisme Luxembourg; daneben diagnostiziert die Kannerklinik am CHL. Die Verfahren kombinieren Verhaltensbeobachtung, strukturierte Eltern-Interviews, kognitive und alltagsnahe Tests. Interdisziplinäre Teams beobachten das Kind in mehreren Situationen; bei Erwachsenen untersuchen sie deren Entwicklungsgeschichte und Schwierigkeiten. Am Ende validiert ein Facharzt für Psychiatrie die Diagnose. Wichtig ist: Es gibt keinen einfachen Test – die Gesamtschau zählt.
Sie sprachen über Schule, Studium, Job. Wo hakt es beim Übergang in die Arbeit?
Viele Menschen mit Autismus bekommen mit Camouflage einfacher eine Stelle, also insbesondere Frauen. Sie verlieren den Job dann aber wieder, weil das Maskieren dauerhaft zermürbt und nicht funktioniert: Arbeitgeber sehen die Leistung, aber nicht die Anstrengung dahinter.
Wir entwickeln deshalb praxisnahe Leitlinien: Reizarme Arbeitsumgebung, klare Routinen, planbare Pausen, verlässliche Kommunikation, echte Wahlfreiheit bei sozialen Aktivitäten: Niemand muss zum Beispiel in der Gruppe in die Kantine gehen. Wer ohne Maske arbeiten darf, hält länger durch – und entfaltet eher seine Stärken.
Welche Rolle spielt die Familie – und was hilft Eltern?
Eltern stehen oft unter Druck. Unsere Studien zeigen: Nicht die Diagnose an sich sagt das Wohlbefinden voraus, sondern wie Eltern Situationen bewerten und welche Bewältigungsstrategien sie nutzen. Wer soziale Unterstützung bekommt und belastende Situationen umdeuten kann, stabilisiert sich – und hilft so indirekt dem Kind. Begleitangebote sollten deshalb die Eltern mitdenken und nicht ausschließlich eine Therapie für das Kind anbieten.
Wie gehen Sie sprachlich vor: Heißt es Autismus-Spektrum oder „Autismus“?
Formal sprechen Diagnosesysteme von „Autism Spectrum Disorder“. Oft hat sich jetzt der Begriff „Autismus-Spektrum“ etabliert, um die Vielfalt der Erscheinungen zum Ausdruck zu bringen. Viele Betroffene bevorzugen aber „Autismus“ oder „Person mir Autismus“, weil es weniger pathologisiert. In Publikationen nenne ich die Klassifikation und nutze dann die personenzentrierte Sprache. Es geht nicht nur um Präzision, sondern auch um Respekt.
Woran arbeiten Sie als Nächstes?
Wir starten ein Projekt, das untersucht, ob Programmieren-Lernen sozio-emotionale Fähigkeiten fördern kann. Außerdem setzen wir unsere Arbeit zu Camouflage am Arbeitsplatz fort – mit konkreten Empfehlungen für Unternehmen in Luxemburg.
Zudem möchten wir die Lernmöglichkeiten für autistische Studierende – insbesondere im Hochschulbereich – weiter untersuchen und zeigen, wie das den Übergang in eine erfolgreiche Beschäftigung erleichtern kann.
Seit Oktober gibt es außerdem ein universitäres Zertifikat
Und was wünschen Sie sich von Gesellschaft und Institutionen mit Blick auf Autismus?
Weniger Barrieren, mehr Mitbestimmung. Wenn wir Reizquellen reduzieren, Erwartungen klären und Alternativen zur „sozialen Pflichtmaske“ schaffen, gewinnen alle: Autistische Menschen und ihre Angehörigen behalten Kraft – und Arbeitgeber ihre Talente. Das kommt auch in der Gesellschaft allmählich an - wir sind auf dem richtigen Weg.
Wodurch entsteht Autismus?
Autismus hat keine einzelne Ursache. Forschung und klinische Praxis zeigen ein Zusammenspiel vieler genetischer und neurobiologischer Faktoren, die schon in der frühen Gehirnentwicklung wirken. Dabei verlaufen Reifung und Verschaltung von Nervenzellen in manchen Bereichen etwas anders, sodass neuronale Netzwerke für soziale Wahrnehmung und sensorische Verarbeitung anders zusammenarbeiten. Das kann erklären, warum Geräusche, Licht oder Berührung teils überwältigen, während Details und Muster oft besonders ins Auge fallen. Wie stark sich das zeigt, reicht von hohem Unterstützungsbedarf bis zu einem selbstständigen Leben – entscheidend ist die passende Begleitung, nicht das Etikett (Wolfers et al 2019; Wang et al 2023).
Zwillings- und Familienstudien sprechen für einen hohen erblichen Anteil: Hunderte genetische Varianten tragen jeweils ein kleines Stück bei, besonders solche, die Synapsen, Signalübertragung und Netzwerkbildung betreffen. Ein einzelnes „Autismus-Gen“ gibt es nicht. Externe Auslöser im Sinne einfacher Erklärungen sind nicht belegt; große Analysen finden insbesondere keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus. Wichtig ist deshalb, von komplexen Wahrscheinlichkeiten nicht auf Schuld zu schließen – so betont es auch Andreia Costa: Autismus entsteht aus vielen Gründen, nicht aus einem vermeidbaren Einzelereignis. Unterstützung setzt daran an, Barrieren zu senken statt Ursachen zu moralisieren (Taylor et al 2014; Wolfers et al 2019; Wang et al 2023).
Interview: Hannes Schlender (scienceRELATIONS)
Redaktion: Jean-Paul Bertemes (FNR)
Infobox
Luke E. Taylor, Amy L. Swerdfeger, Guy D. Eslick, Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies, Vaccine, Volume 32, Issue 29, 2014, Pages 3623-3629. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.085
Wang L, Wang B, Wu C, Wang J, Sun M. Autism Spectrum Disorder: Neurodevelopmental Risk Factors, Biological Mechanism, and Precision Therapy. Int J Mol Sci. 2023 Jan 17;24(3):1819. doi: 10.3390/ijms24031819. PMID: 36768153; PMCID: PMC9915249.
Wolfers, T. et al., From pattern classification to stratification: towards conceptualizing the heterogeneity of Autism Spectrum Disorder, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 104, 2019, Pages 240-254, ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.07.010.