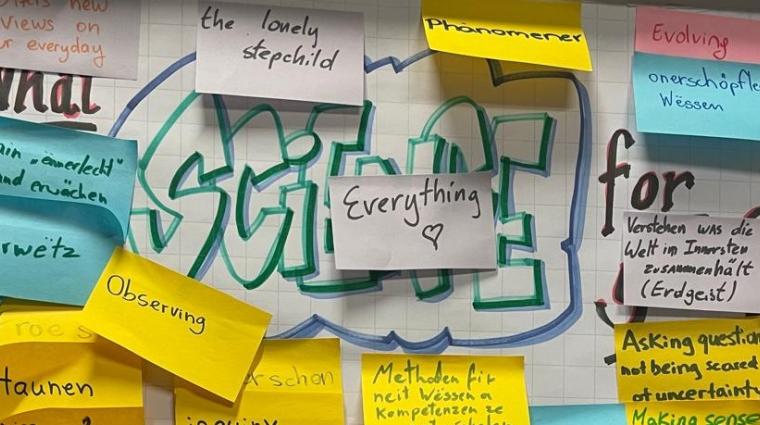FNR, Script
Matériel nécessaire
Cycle : 4
Durée : environ 50 minutes
Dernière mise à jour: 08.03.2024
Déroulement
Afin de vous familiariser avec le déroulement de l’expérience et le matériel, il est important que vous réalisez l’expérience une fois avant le cours.
Vous souhaitez que vos élèves documentent l‘expérience ? À la fin de cet article (au-dessus de la boîte à infos), vous trouverez une fiche de recherche (PDF avec deux pages DIN A4), qui pourrait être utile à vos élèves.
Étape 1 : Posez une question et émettez des hypothèses
La question que vous abordez dans cette unité est la suivante:
Combien d’air nos poumons peuvent-ils contenir ?
Proposition d’introduction : Invitez les élèves à fermer les yeux et à poser les mains sur leur cou puis sur leur cage thoracique (et éventuellement sur leur ventre et leur taille), et à inspirer et expirer profondément à quelques reprises. Les enfants peuvent ainsi suivre eux-mêmes le trajet de l’air respiré. Ils peuvent sentir l’air entrer et sortir et la cage thoracique s’élargir puis se resserrer.
Laissez les enfants formuler des hypothèses sur la quantité d’air (en litres) que leurs poumons peuvent contenir. Pour que les enfants puissent bien se représenter le volume correspondant à un litre, montrez-leur le verre doseur ou faites-leur remarquer que le jus et le lait sont souvent vendus dans des emballages d’un litre.
Autres questions que tu peux poser : Tous les êtres humains ont-ils des poumons de la même taille ? De quoi dépend la taille des poumons ? Y a-t-il des différences entre les enfants et les adultes ? Le volume pulmonaire dépend-il de la taille du corps, de l’état de santé, etc. ? Le volume pulmonaire des personnes sportives est-il plus important que celui des personnes qui pratiquent moins de sport ?
Laissez les élèves énoncer leurs hypothèses (affirmations, suppositions). Dessinez notez vos propositions. Partagez-les avec la classe et motivez vos réflexions. Notez les hypothèses au tableau. À ce stade, le fait de trouver la bonne réponse est secondaire. Il s’agit plutôt de développer des idées et de découvrir ce que les élèves savent déjà.
Demandez aux enfants s’ils ont une idée comment ils pourraient mesurer leur volume pulmonaire à l’aide d’une expérience. Pour les guider vers l’expérience proposée, vous pouvez aussi leur montrer le matériel de l’expérience.
Étape 2 : Réalisez l‘expérience
Pour déterminer leur volume pulmonaire en litres, les enfants mesureront le nombre de litres d’eau qui s’écoulent d’un seau rempli à ras bord lorsqu’on y enfonce un ballon rempli de l’air d’une expiration. Passe en revue les étapes suivantes avec les enfants, mais laisse-les réaliser l'expérience eux-mêmes :
- Placez le seau dans le récipient ou la bassine et remplissez-le à ras bord d‘eau.
- Prenez une grande inspiration et expirez une fois dans le ballon. Essayez de souffler le plus d’air possible dans le ballon en une seule expiration. (Comme certains ballons sont difficiles à gonfler lors de la première utilisation, vous pouvez aussi souffler une fois dans votre ballon au préalable, puis laisser l’air s’échapper.)
- Nouez le ballon.
- Enfoncez à présent le ballon dans le seau rempli d’eau. Essayez de l’enfoncer complètement dans le seau.
- Vous pouvez maintenant verser l’eau qui a débordé et qui a été recueillie dans le récipient ou la bassine dans le verre gradué et en lire le volume.
Étape 3 : Observez ce qui se passe
Selon leur âge, leur forme physique et leur taille, les enfants obtiendront un volume compris entre 1,5 et 3 litres. Ces données se rapportent à des enfants âgés de 10 à 11 ans et mesurant 140 à 145 cm. (Source : www.leichter-atmen.de/lungenfunktionstest-werte).
Comme il est impossible de vider complètement les poumons, le volume réel des poumons est supérieur d’environ un litre aux mesures obtenues.
Est-ce que les résultats correnspondent environ aux estimations des enfants ? Demandez aux enfants de raconter leurs expériences.
Étape 4 : Expliquez le résultat
Les adultes en bonne santé ont un volume pulmonaire de 4,2 à 6 litres. En réalité, seuls 3,5 à 4,8 litres d’air peuvent être déplacés par l’inspiration et l’expiration, car les poumons doivent à tout moment contenir 0,7 à 1,2 litre d’air, par exemple pour éviter que les alvéoles pulmonaires ne s’effondrent et s’accolent.
Comme le volume des poumons dépend de la taille du corps, les enfants ont un volume pulmonaire plus faible que les adultes. Le volume des poumons augmente avec l’âge, mais il diminue aussi à partir de 25 ans environ (Référence : https://www.leichter-atmen.de/lexikon-fev1).
Le volume pulmonaire dépend aussi du sexe et de l’état de santé de la personne. Les femmes ont un volume pulmonaire plus faible que les hommes. Les fumeurs ont un volume pulmonaire plus faible que les non-fumeurs, car l’élasticité des alvéoles pulmonaires diminue avec le temps. Il est possible d’entraîner la capacité de stockage des poumons. Chez les nageurs de compétition, elle peut atteindre jusqu’à huit litres d’air et chez les plongeurs en apnée, elle peut même atteindre jusqu’à dix litres.
Bien entendu, la méthode pour déterminer le volume pulmonaire décrite ci-dessus n’est pas à 100 % exacte scientifiquement : il faut une certaine dextérité pour immerger complètement le ballon sans plonger les doigts dans l’eau. Il se peut également qu’un peu d’air s’échappe lorsque les élèves nouent le ballon. Comme mentionné sous « Observation » , il est impossible de vider complètement les poumons. Le volume réel des poumons est donc plus grand que le volume mesuré.
Vous trouverez une explication détaillée et des infos supplémentaires dans l’infobox.
Remarque : en tant qu’enseignant, vous ne devez pas nécessairement, dans un premier temps, connaître toutes les réponses et explications. Dans cette rubrique « Idées pour l’enseignement des sciences à l’école fondamentale », il s’agit avant tout de familiariser les élèves à la méthode scientifique (question - hypothèse- expérience - observation/conclusion) afin qu’ils apprennent à l’utiliser de façon autonome. Vous pouvez, dans un deuxième temps, chercher ensemble la (les) réponse(s) / explication(s) dans des livres, sur internet ou en questionnant des experts.
Souvent, l’expérience et l’observation (étapes 2 & 3) font émerger de nouvelles questions. Prenez le temps de vous concentrer sur ces questions et de répéter les étapes 2 et 3 en prenant compte des nouvelles découvertes et des autres variables.
Télécharge cette description d'expérience sous forme de projet de cours complet ou de version courte (sans expériences étendues, buts d'excursion et autres informations supplémentaires) en fichier PDF.
Auteurs: Marianne Schummer und Olivier Rodesch (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), Insa Gülzow (scienceRelations)
Photos: FNR/Yann Wirthor
Éditeur: Michèle Weber (FNR)
Concept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)
Révision: Tim Penning, Thierry Frentz (SCRIPT)

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.